Die schlichte Botschaft lautete: Staunen über die Welt. „Eine wie aus der Zeit gefallene Buchreihe berichtet davon, wie schön diese Welt ist“, schrieb der KURIER 2014, als sich der Berliner Matthes-&-Seitz-Verlag mit seiner „Naturkunden“-Reihe an aufwendige Bücher über Esel, Dinosaurier oder Heringe wagte. Das „Nature Writing“, eine literarische Tradition der Naturgeschichtsschreibung, liegt seitdem wieder im Trend. Warum? „Vielleicht, weil die Natur immer mehr verschwindet“, sagt Cord Riechelmann. Der Philosoph und Biologe machte damals mit seiner Natur- und Kulturgeschichte der Krähen den Anfang der Naturkunden-Reihe, die seither auf 111 Bücher über Tiere und Pflanzen, Pilze und Menschen, Landschaften, Steine und Himmelskörper angewachsen ist. Spinnen, Wespen und Ratten wird darin ebenso Tribut gezollt wie den in der Literatur öfter anzutreffenden Füchsen und Hirschen.
„Zum Nature Writing gehört die Expedition zu den Kakerlaken unter dem Kühlschrank genauso wie ein Ausflug in den Yellowstone Nationalpark. Ich schrieb über Krähen, die ich jeden Tag aus dem Fenster meiner Berliner Wohnung sehen kann und auch sonst überall in der Stadt. Es geht um das Gegenwärtige der Natur in unseren Lebensräumen,“ sagt Riechelmann. Wissenschaftliches Schreiben und Literatur lagen früher nicht so weit auseinander – Goethe hat beachtliche naturwissenschaftliche Schriften verfasst. „Darwins Bericht von seiner Reise Die Fahrt der Beagle ist ein Klassiker des Nature Writing und trotz der Tragweite seiner Überlegungen zu dem, was er sah, keine wissenschaftliche Literatur im strengen Sinn. Darwin war aber auch wie Goethe ein großer Stilist, der sehr viel Zeit in das Erscheinungsbild seiner Bücher investierte“, berichtet Riechelmann.
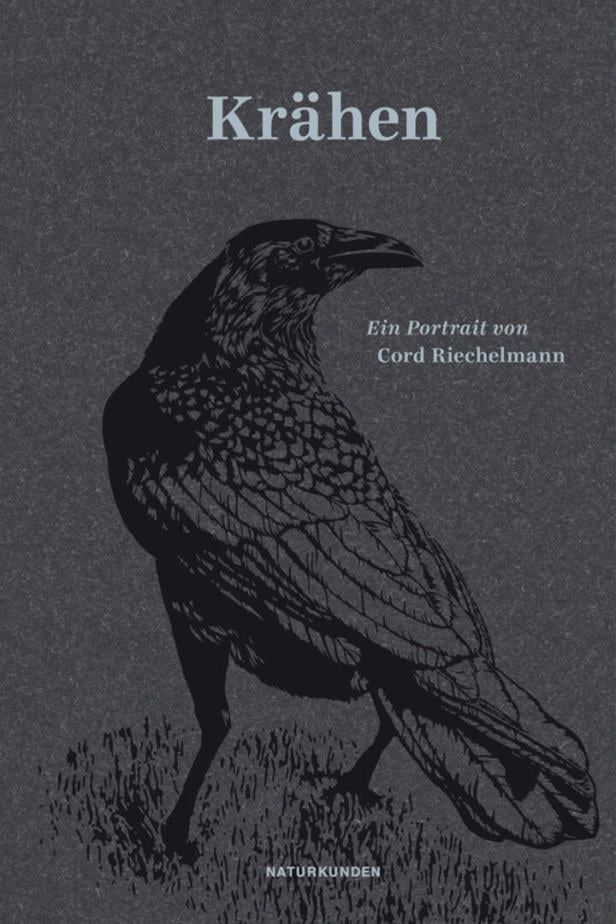
Cord Riechelmann:
„Krähen. Ein Porträt“
Matthes & Seitz.
155 Seiten.
20,95 Euro
Warum haben sich literarisches und wissenschaftliches Schreiben später auseinanderentwickelt? Weil die heute international gewordenen Naturwissenschaften den persönlichen Stil eines Autors nur bedingt vertragen, glaubt Riechelmann, der darin auch den Unterschied zwischen wissenschaftlichem und literarischem Schreiben sieht: „Nature Writing verschweigt die persönlichen Empfindungen nicht.“
Es ist schwer zu beziffern, wie viel zeitgenössische Literatur sich mit Tieren beschäftigt. Wer jedoch viel mit Büchern zu tun hat, der weiß: Es ist eine Menge. 2020 stellten die Autorin Jana Volkmann und der Autor Luca Kieser fest, dass sie beide an Tiermanuskripten arbeiteten. Man kam ins Gespräch, gab einander Lektüreempfehlungen. So entstand ein Lesekreis, der sich seither in unregelmäßigen Abständen zur Diskussion von Tierlektüren zusammenfindet. Einige der Autoren und Autorinnen stellen wir hier vor.

„Ich finde Kellerasseln und Würmer genauso interessant“
Philipp Weiss schreibt über Tiere, um die Welt als Ganzes zu begreifen
Über Tiere schreiben? Ja, gerne. Philipp Weiss tut das eigentlich immer, er hat das in gewisser Weise auch schon bei seinem ersten Roman getan. Aber vielleicht ein bisschen anders, als man sich das gemeinhin so vorstellt. „Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen“ hieß der 2008 erschienene Mammut-Roman des Wieners. Grob gesagt geht es darin um das Verhältnis des Menschen zur Natur. Intelligente Hunde und selbstbewusste Katzen kommen darin nicht vor. Weiss bevorzugt Mikroben und hin und wieder auch Wale – obwohl Letztere weltliterarisch gesehen doch schon öfter zu Ehren gekommen sind. Weiss geht es bei Mikroben und Walen aber um mehr. Es geht ihm um das Kleinste und das Größte, um die Zusammenhänge. Natürlich, sagt Philipp Weiss, gibt es diese charismatischen, ikonischen Tiere, über die sehr viel geschrieben wird. Die, die den Menschen irgendwie nah sind. Sie treten oft in Büchern auf, oft mit menschlichen Eigenschaften ausgestattet. Aber das Tierreich, ja, die Welt darüber hinaus, ist viel, viel größer. Philipp Weiss steckt gerade mitten in der Arbeit für seinen neuen Roman. „Die Unruhe der Planetenhaut“ soll 2027 erscheinen. Tiere gibt es darin einige. Zum Beispiel Bakterien, Viren und auch andere, denen in der Literatur meist wenig Beachtung geschenkt wird. „Ich finde Kellerasseln und Würmer mindestens genauso interessant wie jene Tiere, die uns auf den ersten Blick ähnlicher sind. In meiner Arbeit geht es aber um etwas anderes als um das süße Tier. Es geht mir um das große Ganze. In der Welt der Mikroben eröffnen sich ungeheure Kosmen, die uns weitgehend verborgen sind.“
Weiss will Brücken bauen. Von der Welt der Mikroben bis zu jener der Wale. Er will den Planeten und die Biosphäre aus allen erdenklichen Perspektiven betrachten. Will Geschichten aus verschiedene Blickwinkeln erzählen und deren Zusammenhänge zeigen. Es ist sein Versuch, „planetar“ zu denken, „weil unser Leben von diesen Zusammenhängen geprägt ist, wir sie aber nur schwer begreifen können. Wir können uns das, was uns ähnlich ist, viel leichter vorstellen. Was darüber hinaus geht, nicht. Doch das ist mindestens ebenso interessant und wichtig für unsere Existenz.“
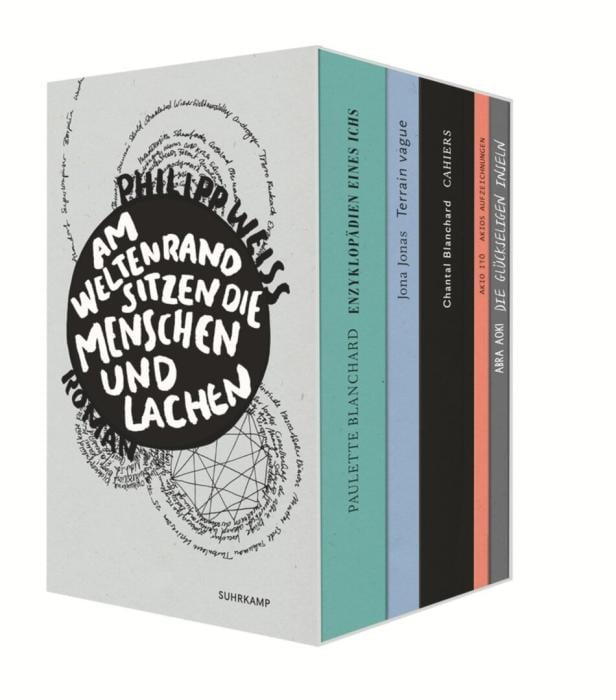
Philipp Weiss:
„Am Weltenrand
sitzen die Menschen und lachen“
Suhrkamp.
1000 Seiten.
49,40 Euro
Als Beispiel nennt Weiss Algen: Sie stehen nicht gerade im Mittelpunkt der menschlichen Wahrnehmung und schon gar nicht des literarischen Erzählens. Allerdings sind Algen wichtige Sauerstofflieferanten; unsere Existenz hängt also in gewisser Weise auch von Algen ab. Weiss will diese Zusammenhänge zeigen. Dazu gehört für ihn auch, dass der Mensch sich nicht als Krone der Schöpfung und als über allen Dingen der Erde stehend sehen sollte. Schließlich hängt alles mit allem zusammen. Weswegen auch die Trennung zwischen Tier und Mensch in gewisser Weise künstlich und letztlich mitverantwortlich für die ökologischen und klimatischen Krisen der Gegenwart sei – die Natur werde als „endlose Ressource“ betrachtet.
„Über Tiere schreiben“ bedeutet für Weiss somit, „als Tier“ über Tiere zu schreiben. „Menschen sind Raubtiere, die es verstehen, zu denken und zu lieben.“ Dass Menschen mit Schimpansen einiges teilen, ist den meisten klar. Weniger aber wissen wir über Gemeinsamkeiten mit Rochen, mit Fruchtfliegen oder mit Zebrafischen. „Wir sind nicht nur materiell, sondern auch evolutionär genetisch verflochten und somit Teil eines hochkomplexen Netzwerks.“ Und was ist mit der Behauptung, der Mensch unterscheide sich von Tieren durch Sprache, durch Bewusstsein, durch Moral oder Werkzeuge? Längst widerlegt. „Es gibt reichlich Dokumentationen von Tieren, ob von Krähen oder Schimpansen, die Werkzeuge verwenden oder auch fremde Sprachen beherrschen.“

Charles Foster:
„Der Geschmack von Laub und Erde“
Malik. 288 Seiten. 20 Euro
Das Buch, das Weiss bei dieser Gelegenheit empfiehlt, ist das erzählende Sachbuch „Der Geschmack von Laub und Erde“ von Charles Foster. Darin beschreibt der Brite, der in Oxford Rechtsmedizin und Ethik unterrichtet, ein fantastisches Selbstexperiment. Er schlüpfte in die Rolle von fünf verschiedenen Tierarten: Dachs, Otter, Fuchs, Rothirsch und Mauersegler und versuchte, wie sie zu leben.
„Wir Menschen sehen ja nur das, was wir auch in Worte fassen können. Jeder Mensch schafft so seine eigene Realität. Und so ist es auch mit Tieren. Jedes Lebewesen schafft über seine spezielle Physiologie eine subjektive Erfahrung“, sagt Weiss. Charles Foster wollte mit seinem Selbstversuch diese Grenzen der subjektiven Realität überwinden. Im Versuch, als Tier zu leben, grub er seinen eigenen Dachsbau, ernährte sich von Regenwürmern und versuchte, die Welt über den Geruch wahrzunehmen. Er durchwühlte als Stadtfuchs die Mülleimer in London und versuchte, als Rothirsch als Beutetier zu leben. Eine ziemlich neue Erfahrung für das Raubtier Mensch.

Der Protagonist von Jana Volkmanns jüngstem Roman ist ein altes Fiakerpferd. Ganz persönlich wüsste sie gerne, was in ihren Katzen vorgeht
„Ich schreibe mit zwei Katzen an meiner Seite“
Jana Volkmann über Geheimnisse, die Menschen gerne von Tieren erfahren würden
Es sei ein nachvollziehbarer Wunsch, sagt Jana Volkmann, dass Menschen eine gemeinsame Sprache mit Tieren entwickeln wollen. „Einfach, um genauer zu wissen, was in Tieren vor sich geht. Worüber sie sich Gedanken machen, wenn sie einen anschauen, wenn sie aus dem Fenster blicken und was sie träumen, wenn sie in der Nacht zucken.“ Es ist die Art von Geheimnis, die Menschen einander mitteilen können. „Sich von diesen inneren Prozessen erzählen zu können, ist für zwischenmenschliche Beziehungen wichtig. Das ist etwas, was ich gerne auch von meinen Katzen wüsste, aber ebenso von anderen Tieren.“ Jana Volkmann hat gerade einen berührenden Roman über eine ungewöhnliche Tier-Mensch-Wohngemeinschaft samt lädiertem Fiakerpferd, Beagle mit derangiertem Ohr und Katze mit ausgeprägtem Jagdtrieb geschrieben. Der zweite Roman der in Wien lebenden gebürtigen Kasselerin ist eine humorvolle Kleinstfamiliengeschichte mit bewegend schönen, zärtlichen Tierbeschreibungen und ein Plädoyer für ein Zusammenleben aller auf Augenhöhe.

Jana Volkmann:
„Der beste Tag seit Langem“
Residenz.
249 Seiten. 26,95 Euro
Die Vorstellung, mit Tieren zu kommunizieren, sei oft von einem gewissen Wunschdenken geprägt. „Mit Haustieren stehen wir in einer Beziehung und können uns zumindest einreden, dass wir halbwegs wissen, was mit ihnen los ist. Hunde etwa können sich gut mitteilen und klare Signale senden. Aber es gibt noch so viel, das wir nicht wissen.“ So geht es etwa bei der Frage, ob Tiere träumen können, viel um Interpretation. Dazu gibt es auch viel populärwissenschaftliche Literatur. „Anhand bestimmter Gehirnaktivitäten wird der Schluss gezogen, dass Hunde von Menschen träumen, weil Liebesareale im Schlaf sehr aktiv sind. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob da nicht sehr viel Wunschdenken dabei ist. Denn der Mensch ist da immer der Mittelpunkt der Welt der Tiere und es geht nur um die Liebe, Hingabe und Loyalität der Tiere zu ihm.“
Das Verhältnis von Mensch und Tier ist zudem stark von Hegemonie und Hierarchie geprägt. „Es ist völlig klar, dass wir immer am längeren Ast sitzen. Das ist auch eine bittere Erkenntnis.“
Das Buch, das Volkmann zu diesem Thema empfiehlt, heißt „Liebes Tier“ und stammt von der französischen Philosophin Hélène Cixous. Es handelt von der Liebe zwischen Tier und Mensch, von den Verständnissen, aber auch den Missverständnissen zwischen den beiden. „Dieses Buch ist wunderschön, aber es hat auch seine Abgründe“, sagt Volkmann, „denn die Beziehungen zwischen Menschen und Tieren sind nicht immer einfach“. Cixous’ Eingangszitat hat Volkmann auch ihrem eigenen Roman vorangestellt. „Ich schreibe mit zwei Katzen an meiner Seite, während ich an euch denke. Möge ich sie niemals verraten, denn damit verriete ich mehr als mich selbst, ich verriete das Beste vom Menschen.“

Autor Luca Kieser hat einen vielstimmigen Roman über einen Riesenkalmar geschrieben. Er sagt: „Wir sind auch Tiere. Aber Tiere sind nicht bloß Menschen mit Abzügen“.
Im Kopf der Riesenkrake: Luca Kieser über tentakuläres Denken und vielarmiges Erzählen
Wie Luca Kieser auf den Oktopus gekommen ist? Eher hat das Tier, das in den letzten Jahren in der Kulturwelt so viel von sich reden machte, ihn gefunden. Tatsächlich hat der Oktopus die Menschen immer schon fasziniert. Bereits in der griechischen Mythologie kam Skylla vor, ein Oktopus-ähnliches Seeungeheuer. In den vergangenen Jahren hat sich etwas in der Wahrnehmung verändert und der Oktopus ist vom Ungeheuer zu einem Tier geworden, von dem wir mutmaßlich viel lernen können. „Weil da war etwas im Wasser“ heißt Kiesers 2023 veröffentlichter Debütroman über einen Riesenkalmar, dessen Arme und Tentakeln Geschichten erzählen. Eine große Inspiration war für Kieser dabei die US-amerikanische Philosophin Donna Haraway, die mit dem Manifest des „tentakulären Denkens“ zu einer Verbundenheit mit dem, was uns nicht ähnlich ist, aufgerufen hat.
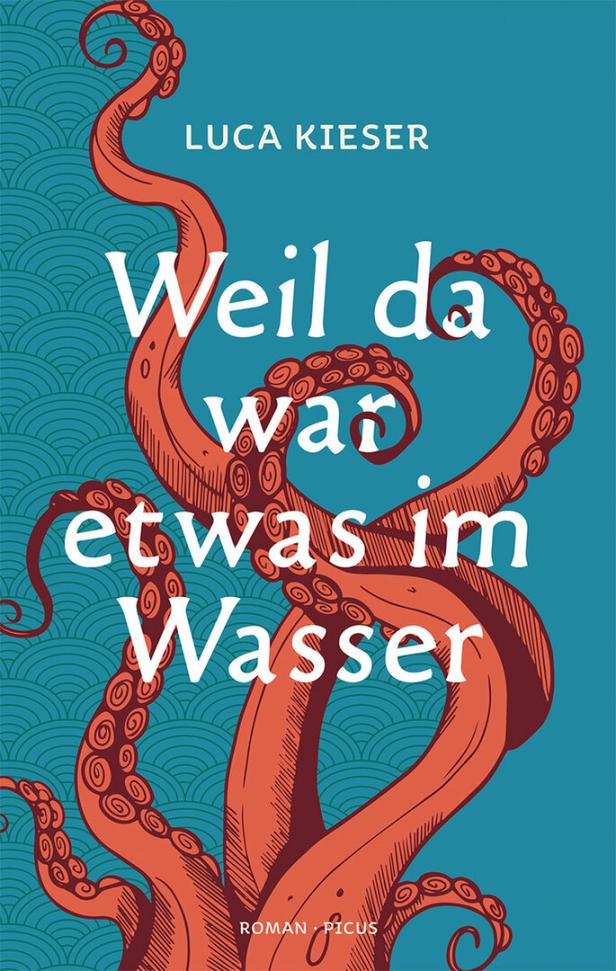
Luca Kieser:
„Weil da war etwas im Wasser“
Picus.
320 Seiten. 26 Euro
„Ich habe versucht, in meinem Roman so etwas wie Tentakuläres, also vielarmiges Erzählen zu betreiben“, sagt Kieser. Und dann war da der Gedanke: Was, wenn Tintenfische die Fähigkeit, Tinte zu spritzen, entwickelt haben, um schreiben zu können? „Mich fasziniert die Vorstellung, dass Tiere womöglich Dinge tun, die über das, was wir für wahrscheinlich halten, hinausgehen.“ Wäre es nicht einfacher gewesen, ein Buch über einen Hund oder eine Katze, die uns näher stehen, zu schreiben? „Es wäre vermeintlich einfacher gewesen. Aber als Schreibender muss man sich Widerständen stellen. Man schreibt immer über andere. Darin liegen auch die Schwierigkeiten. Man steckt eben nicht in der Haut des anderen.“
Kiesers Buchtipp: „Was würden Tiere sagen, würden wir die richtigen Fragen stellen?“ von Vinciane Despret. Die belgische Philosophin beschreibt darin Anekdoten, die überraschen. Zum Beispiel: Wie trauern Elefanten? Über Tiere schreiben, sagt Luca Kieser, ist eine gute Schule für Schriftsteller. „Wir Menschen sind auch Tiere. Aber Tiere sind nicht bloß Menschen mit Abzügen.“

Evolutionsbiologin Andrea Grill schrieb zuletzt über Seepferdchen
Von Seepferden und Menschen: Andrea Grill über Nachrichten von den Göttern
Sie schrieb über Schmetterlinge, Schmetterlingsforscher und über die Frage, was Schmetterlinge fühlen. Zuletzt veröffentlichte sie ein Buch über die wie mythische Gestalten anmutenden Seepferdchen. „Pferdeähnliche Meereswesen“ hatte sie der schwedische Naturforscher Carl von Linné einst genannt – etwas prosaischer ausgedrückt gehören sie zu den Knochenfischen.
Literatur war für die promovierte Evolutionsbiologin Andrea Grill immer mindestens so wichtig wie Forschung. „Ich begann, Biologie zu studieren im Wissen, ich will schreiben. Ich war 20 und dachte: Wenn ich es irgendwann einmal schaffe, zu veröffentlichen, kann ich sterben. Mein Lebensziel ist erreicht. Das habe ich dann irgendwann mit 28 oder 29 geschafft. Ich bin zum Glück nicht gestorben.“
Andrea Grill ist im Salzkammergut aufgewachsen. Mit Hunden, Katzen, Vögeln, Hamstern, Fischen. Wald und Wiese waren ihre Freunde. Alles, was dort kreuchte und fleuchte, allen voran die Insekten. Ihre Doktorarbeit schrieb sie über Schmetterlinge. Sie züchtete Schmetterlinge und jahrelang begann und endete jeder Tag mit dem Gedanken an Schmetterlinge. Sie wusste also, wie sich einer wie der Wiener Schmetterlingsforscher Franz Wilhelm Caspari fühlen musste, den sie für ihren Roman „Das Paradis des Doktor Caspari“ erdachte.
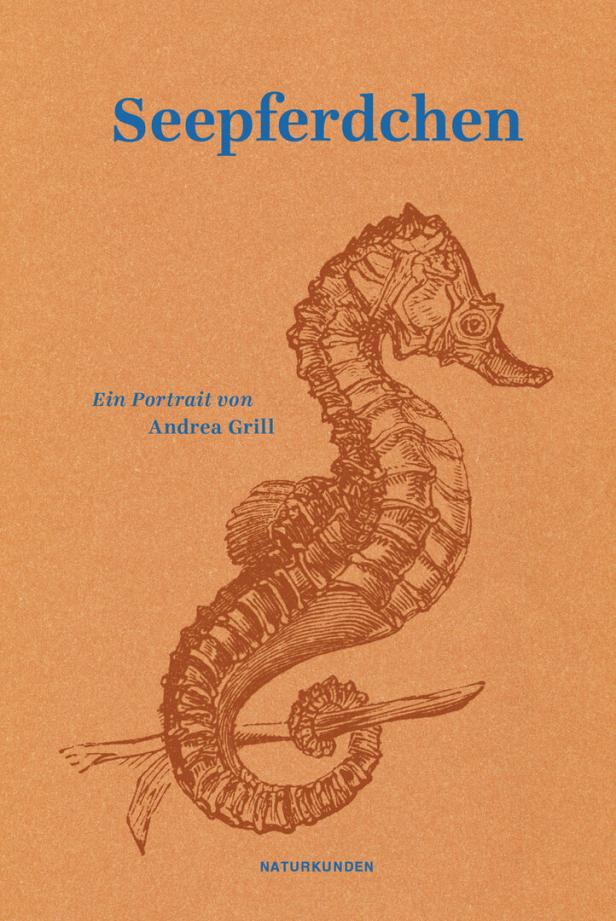
Andrea Grill: „Seepferdchen.
Ein Portrait“ Matthes & Seitz.
143 Seiten. 23,50 Euro
Unlängst hat Andrea Grill mit ihrem in der „Naturkunden“-Reihe erschienenen Buch über Seepferdchen ein wissenschaftliches, aber zugleich literarisches und sehr persönliches Projekt verwirklicht. „Natürlich sind Seepferdchen keine Wesen, die uns nah wie Hunde und Katzen sind. Aber sie haben durch ihre Körperform und ihr Schnäuzchen etwas Possierliches, das sie uns sympathisch macht.“ Früher hielt man Seepferdchen für Drachen mit Nachrichten von den Göttern. Früher, als Wissenschaft und Literatur näher beieinander waren. Als Goethe auch Naturforscher war und Humboldt wunderschöne, gut zu lesende Texte schrieb. Auch Vladimir Nabokov war, neben seiner belletristischen Arbeit, ein umtriebiger Schmetterlingsforscher, der viel publizierte. Natürlich liebt Andrea Grill seine Texte. Empfehlen möchte sie an dieser Stelle allerdings Gedichte: Mara-Daria Cojocarus „Buch der Bestimmungen“ erzählt von Gesprächen zwischen Katzen und Füchsen, von Wasserbären im Weltall und von desinteressierten Rehen.

Bettina Balàka mit ihrem Terrier-Dackel-Mischling Bubi, Held eines Romans und mit 15 Jahren immer noch heiter und quirlig
Was man vom eigenen Hund alles lernen kann:Bettina Balàka weiß, dass Körpersprache mehr bewirken kann als Bellerei
Es gab Zeiten, da lebte die Salzburger Schriftstellerin Bettina Balàka mit Hund, Katzen, Schildkröte und Einsiedlerkrebsen. Nicht zu vergessen den Rennmäusen ihrer Tochter. Heute ist ihr Terrier-Dackel-Mischling alleiniger Herr im Haus. Der heitere, mit seinen 15 Jahren immer noch quirlige Hund ist sichtlich froh darüber.
Vor zehn Jahren hat Bettina Balàka ihm den Roman „Unter Menschen“ gewidmet. „Als Schriftstellerin habe ich mich natürlich mit Hundepsychologie befasst, und zwar bis ins Detail. Ich habe mich eingelesen und wir haben gemeinsam diverse Kurse absolviert. Ich bin immer mehr in dieses Hundeleben hineingekippt, bis es selbstverständlich war, darüber zu schreiben. Mich faszinierte die Erweiterung meiner Wahrnehmung. Etwa, weil der Hund viel besser hört als ich. Ich habe dadurch auch gelernt, genauer hinzuhorchen. Ich habe von ihm überhaupt wahnsinnig viel gelernt. Einfach, indem ich ihn kopiert habe. Wir beide wissen, dass man mit Körpersprache oft mehr erreichen kann als mit Bellerei.“
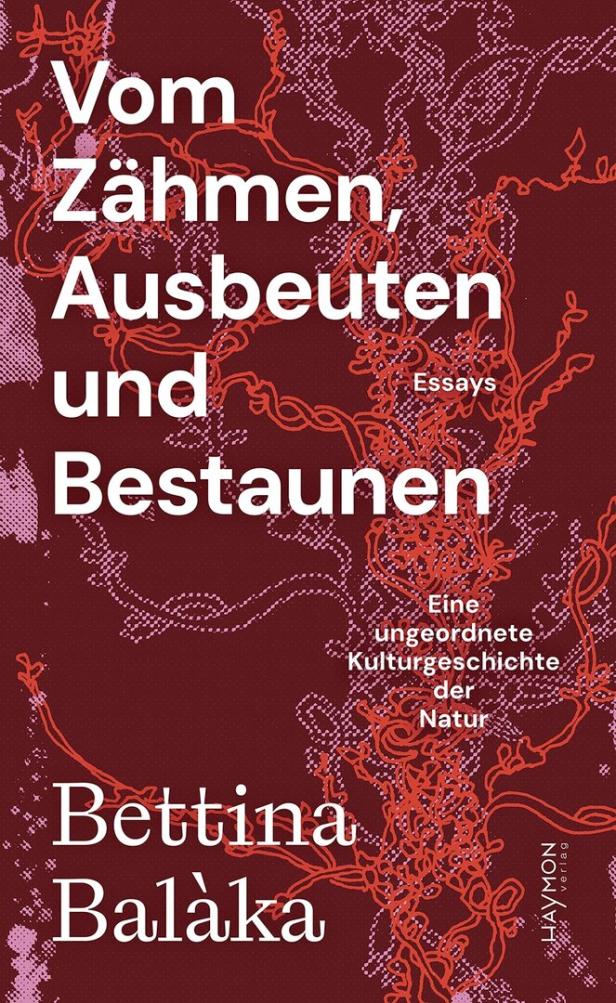
Bettina Balàka:
„Vom Zähmen, Ausbeuten und Bestaunen“
Haymon.
216 Seiten. 22,90 Euro
Balàka beschäftigt sich oft literarisch mit Tieren, so auch in ihrem aktuellen Essayband „Vom Zähmen, Ausbeuten und Bestaunen“. „Natürlich gibt es einen Trend, sich mit der Umwelt zu beschäftigen, jetzt wo sie so kaputt ist. Es gibt nur mehr wenig echte Wildnis und umso mehr beschäftigen wir uns mit dem, was da die letzten paar 100 Jahre gedankenlos zerstört wurde.“
Für sie persönlich sind immer noch Hunde am spannendsten. „Wir tun ja immer so, als hätten wir die Wölfe gezähmt. In Wahrheit haben wahrscheinlich sie sich uns angeschlossen. Sie haben die Initiative ergriffen. Das ist zumindest eine schöne Vorstellung.“ Ihre Buchempfehlung: Eine Erzählung von Patricia Highsmith aus ihrem Kurzgeschichtenband „Der Schneckenforscher“. Da gibt es eine Story namens „Die Schildkröte“. Darin geht es um einen kleinen Buben und seine Sumpfschildkröte, die seine Mutter wiederum als geeignet fürs Ragout hält …

Barbi Marković nennt Hunde „Leute“ und findet, Tiere sollen in der Literatur als Charaktere ernst genommen werden
„Ich glaube an echte Freundschaften mit Tieren“: Barbi Marković erzählt von Hunden, die so schön wie berühmte Sängerinnen sind und von Katzen, die Aufzug fahren können
In Barbi Markovićs Kurzgeschichtenband „Minihorror“ werden gewohnte Hierarchien zwischen Menschen und Tieren umgekehrt, daher rührt ja auch der Horror. Ob es sich bei den handelnden Personen um Menschen oder Tiere handelt, ist allerdings nicht immer ganz klar. „Es ist wie in Entenhausen“, sagt Marković. „Dort gibt es auch fleischfressende Kühe und Enten, die zu Thanksgiving Truthahn essen.“
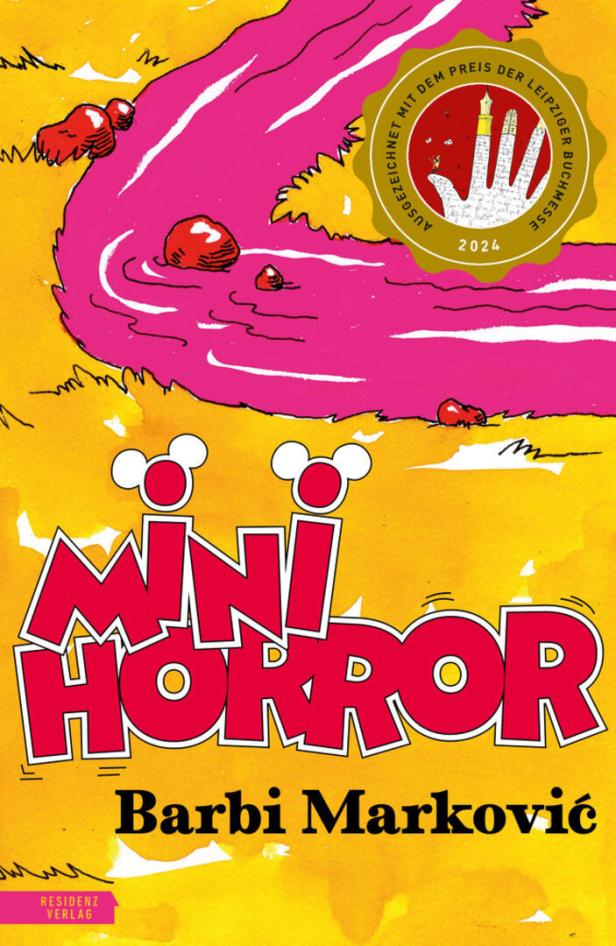
Barbi Marković:
„Minihorror“
Residenz.
192 Seiten. 24 Euro
Tiere waren immer Thema für Barbi Marković. Als Kind traf sie sich am liebsten mit Hunden im Park. „Wir sind gemeinsam hingegangen, haben Sachen erlebt und uns später wiedergetroffen. Das waren wirkliche Freundschaften. Ich glaube an echte Freundschaften mit Tieren.“ Deshalb ist es ihr auch wichtig, dass Tiere in der Literatur als Charaktere ernst genommen werden. In den Büchern, die sie mag, ist das so. Etwa in Jack Londons Abenteuergeschichte „Michael, der Bruder Jerrys“. Sie ist 1917 erschienen, Marković hat sie in einer Übersetzung von Erwin Magnus gelesen. Die Erzählung sei heute aufgrund rassistischer Ausdrücke schwer lesbar, aber die Freundschaft zwischen Mensch und Hund beeindruckt immer noch. „Das Buch spielt stark mit der Frage: Wie sehr können wir verstehen, was ein Tier will? “
Barbi Marković glaubt fest an dieses Verstehen. Auch ihr erstes eigenes Buch handelte von einem Hund. Genauer einer Hündin, die aus ihrem Leben erzählte. „Ich bin aber nicht sehr weit gekommen. Ich war neun, mir fehlte die Ausdauer.“ Mittlerweile ist sie ein bisschen älter und sicher, dass sie demnächst wieder über Hunde schreiben will, sie nennt sie die „Leute, die ich früher kannte“.
Bei den Markovićs daheim gab es früher wenig Platz, aber Platz genug für Tiere. „Wir waren zwei Familien in einer Wohnung und jede Familie hatte eigene Katzen. Die waren so schlau, die konnten sogar mit dem Aufzug fahren und beim richtigen Stock aussteigen. Nur die Rassekatze war zu blöd. Ich hatte außerdem einen Papagei und eine Zeit lang haben wir Hunde vor den Hundefängern versteckt.“
In Barbi Markovićs Kinderuniversum am Rande von Belgrad gab es hinkende Hunde, einäugige Katzen und sie wollte sie alle retten. Da war auch diese wunderschöne gelbe Hündin, die alle in der Nachbarschaft kannten. Sie war so schön wie die berühmte Sängerin Lepa Brena, weshalb man auch die Hündin so nannte. Lepa Brena, die Hündin, ging in einer Alkoholikerkneipe ein und aus, was der Schönheit langfristig abträglich war. Sie verlor ihr Fell.
Noch trauriger war die Sache mit Dora. „Das war das Schlimmste, was mir jemals hundemäßig passiert ist. Alle im Haus haben diesen Hund geliebt. Dora war wahnsinnig intelligent. Wir haben uns zu sechst um sie gekümmert, sie hat vor dem Haus auf uns gewartet, uns in die Schule begleitet, konnte Tricks ohne Ende.“ Irgendwann wurde Dora aggressiv, hat gebissen und es hat kein gutes Ende mit ihr genommen. Aber Barbi Marković wird wohl irgendwann einmal über sie schreiben.

Post a Comment